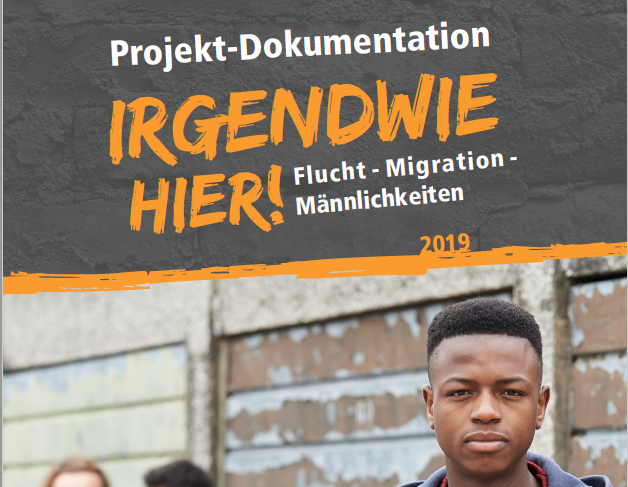Der nachfolgende Text basiert auf den Erfahrungen einer Qualifikationsreihe, die im Rahmen des Projekts „Irgendwie hier – Flucht, Migration, Männlichkeiten“ der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW und in Kooperation mit drei Kooperationseinrichtungen aus Nordrhein-Westfalen erarbeitet wurde und erschien in der Projektdokumentation 2019 der Lag Jungenarbeit.
Von Jonas Lang, Coach e.V.
Dieser Text ist verfasst aus einer rassismuskritischen Verbündetenperspektive. Er ist verfasst aus einer Perspektive, der sich die persönliche Erfahrung von Rassismus entzieht, im Folgenden auch „weiß“ genannt, und kann, bzw. will daher nicht den Anspruch verfolgen, eine Empowermentperspektive zu beleuchten. Er ist gleichermaßen aus einer professionstheoretischen Perspektive Sozialer Arbeit geschrieben, deren Auftrag sich aus der Sozialen Frage und damit aus der Reaktion auf nationale wie auch globale Ungerechtigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse formuliert.
Rassismuskritik ist daher ein elementarer Bestandteil der professionellen Auftragslage (sozial)pädagogischer Fachkräfte. Gerade weiße Fachkräfte sind aus diesem Grund gefordert, ihr Mandat als Menschenrechtsprofession rassismuskritisch auszulegen und Rassismuskritik sowohl in Lehre als auch in der Praxis Sozialer Arbeit seiner Beliebigkeit zu entheben. Aus diesen Überlegungen heraus ist Rassismuskritik in seiner intersektionalen Verbindung mit kritischer Männlichkeit auch ein Kernbestandteil der Qualifizierungsangebote der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW.
Die nachfolgenden Kapitel verstehen sich als Reflexionen wie auch Kontextualisierungen von Diskursen, die sich innerhalb dieser Qualifizierungsangebote gemeinsam mit Fachkräften aus NRW ergaben. So soll sich dieser Text nicht nur als Einladung zu einer diversitätsorientierten, diskriminierungskritischen Organisationsentwicklung verstehen, sondern gleichzeitig dazu beitragen, die historischen Besonderheiten von Rassismus im deutschsprachigen Diskurs mit einer intersektionalen, postkolonialen und nationalismuskritischen Perspektive zusammenzudenken.
Begriffsarbeit als Organisationsentwicklung
„Rassismus“ hat im deutschen Diskurs eine relativ kurze Begriffsgeschichte, galt doch die vermeintliche Überwindung des Nationalsozialismus gleichermaßen als die Überwindung von Rassismus. Dementsprechend wird der Begriff „Rassismus“ gerade in deutschsprachiger Literatur jenseits der 1990er Jahre kaum vorfindbar sein zugunsten von Begriffen wie „Fremdenfeindlichkeit“, „Ausländerfeindlichkeit“, Xenophobie“ gegebenenfalls auch „Rechtsextremismus“ (vgl. Stoop 2018; Messerschmidt).
Rassismus hat demzufolge im innerdeutschen Diskurs gewisse Eigenarten, die es zu verstehen gilt. So ist der Begriff enger an die nationalsozialistische Vernichtungsideologie gekoppelt, als an das koloniale Erbe Deutschlands. Deshalb wird Rassismus nicht selten als historisch abgeschlossenes Kapitel, oder allenfalls als ein Randphänomen extrem rechter Gruppierungen verortet.
Die Thematisierung von Rassismus unterliegt im Zuge dessen den Schuldabwehrreflexen und -projektionen, die der Vergangenheitsbewältigung im postnationalsozialistischen Deutschland inhärent sind. Adorno konkretisierte diese gesellschaftlichen Verdrängungsmechanismen bezüglich der nationalsozialistischen Täterschaft Deutschlands in einem 1959 erschienenen Aufsatz, wenn er schreibt:
„Ohnehin definiert es die heute herrschende Ideologie, dass die Menschen, je mehr sie objektiven Konstellationen ausgeliefert sind, über die sie nichts vermögen […], desto mehr dies Unvermögen subjektivieren. Nach der Phrase, es käme allein auf den Menschen an, schieben sie alles den Menschen zu, was an den Verhältnissen liegt, wodurch dann wieder die Verhältnisse unbehelligt bleiben.“
Analog dazu äußert sich diese Verdrängungsleistung auch hinsichtlich der Betrachtung von Rassismus weniger in der Leugnung seines Vorhandenseins als vielmehr im Leugnen der eigenen Verstrickung in rassistische Verhältnisse. Es wird aus dieser Betrachtung heraus erklärbarer, warum der Diskurs um Rassismus auf der Organisationsebene so häufig individualisiert und auf die Debatte um rechtsextreme Unterwanderung sozialer Einrichtungen verkürzt wird. Hinter dieser Verkürzung vergeht aber die Betroffenenperspektive auf Rassismus als Alltagserfahrung, die sämtliche Lebensbereiche durchzieht. Was Claus Melter als das „Schweigen der PädagogInnen“ konstatiert (ebd.: 115ff), manifestiert sich in erster Linie in der Beliebigkeit, mit der sich weiße Fachkräfte dem Begriff des Rassismus annähern.
Die Alltagserfahrungen rassistischer Diskriminierung im öffentlichen Raum, z. B. in Ämtern, Schulen, Diskotheken, bei der Wohnungssuche, durch rassistische Polizeikontrollen, in Schwimmbädern, etc. erscheinen auf diese Weise als subjektiv verhandelbar, oder werden erst gar nicht thematisiert, bzw. erfragt. Dabei gibt es eine Vielzahl populärer definitorischer Annäherungen an den Rassismusbegriff, die bei aller unterschiedlicher Akzentuierung nicht hinter den Kern eines gesellschaftlichen Strukturprinzips zurücktreten und dennoch keine allgemein verbindliche Wirkung in Konzeptionen, Projekten, Satzungen, etc. entfalten.
Die Beschäftigung mit Rassismus, so scheint es, hat in vielen Organisationen Sozialer Arbeit nicht den Stellenwert eines professionellen Standards. Sie bedarf folglich nicht nur des rein faktischen Wissens, sondern vielmehr der Bereitschaft, sich gemeinsam in einen internen Diskurs um die persönliche Haltung zu begeben und bestenfalls einen gemeinsamen, für die Organisation bindenden Begriff zu erarbeiten, zu vereinbaren und festzuhalten, ohne dabei gesichertes Wissen um Rassismus zu unterminieren. Dieser Prozess bietet die Grundlage, innerhalb der eigenen Organisation eine Rassismus-, ggf. auch Diskriminierungsbeauftragte Person zu benennen und auszustatten oder Rassismuskritik als präventives Element hin zu einem intersektional angelegten Schutzkonzept einzuarbeiten, etc..
Intersektionalität als solidarische Praxis
Mit dem Begriff der Intersektionalität gelang es der Juristin Kimberlé Crenshaw 1989 im Aufsatz „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics“, eine neue Sichtweise auf das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungskategorien zu entwickeln, und anhand arbeitspolitischer Kämpfe von black women of color innerhalb US-amerikanischer Konzerne aufzuzeigen, inwiefern weder eine rein rassismuskritische, noch eine rein sexismuskritische Perspektive die Lebenswelten dieser abbildeten.
Crenshaw analysiert, dass in herkömmlichen rassismuskritischen Analysen vornehmlich die Diskriminierungserfahrungen afroamerikanischer Männer in den Blick genommen wurden, während sich in sexismuskritischen Diskursen ausschließlich die Perspektiven weißer Frauen wiederfanden. Die spezifische Situation von black women of color hingegen ließe sich in beiden Perspektiven nicht abbilden. Crenshaw zeigt in ihrem Aufsatz eindrücklich, dass verschiedene Kategorien von Diskriminierung nicht nebeneinander her existieren, und sich auch nicht einfach aufaddieren, sondern dass die Verschränkung verschiedener Kategorien spezifische Formen von Diskriminierung erzeugen können, wenn sie schreibt:
„Similarly, providing legal relief only when Black women show that their claims are based on race or on sex is analogous to calling an ambulance for the victim only after the driver responsible for the injuries is identified […] Black women can experience discrimination in ways that are both similar to and different from those experienced by white women and Black men“ (Crenshaw 1989: 149).
Inzwischen ist der Diskurs um Intersektionalität auch im deutschsprachigen Raum angekommen und weiter ausdifferenziert. Aus einer jungen*arbeiterischen Sicht lässt er sich ebenso auf das Zusammenspiel von Männlichkeiten und Rassismuserfahrung übertragen. Vom Bornheimer Schwimmbad bis zur Essener Tafel finden sich wiederkehrend populäre Beispiele von Verstößen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz denen spezifisch geflüchtete Jungen* und Männer*, bzw. Jungen* und Männer* of color ausgesetzt sind. Und während diese Beispiele noch den Anschein der rechtlichen Ahndungsfähigkeit erwecken, so sind die kontinuierlichsten Formen der Diskriminierung besagter Personengruppe durch die staatliche Ordnung selbst produziert, sei es in Form von racial profiling, oder aber im rechtlichen Konstrukt der „Bleibeperspektive“. Dieses an anderer Stelle als „begriffliche Seifenblase“ kritisierte Konstrukt ist seit seiner Einführung im Asylpaket I (Okt. 2015) zum „zentralen Instrument der Verweigerung von Teilhabechancen avanciert“ (Voigt 2016) und legitimiert in der maximalen Exklusionsform die Abschiebung vornehmlich männlicher* Geflüchteter.
Der Begriff der Intersektionalität ist hierbei nicht nur als wissenschaftlich neutrale Analysekategorie zu verstehen. Er birgt viel mehr noch den Appell, verschiedene Erfahrungen von Diskriminierung nicht in Konkurrenz miteinander zu setzen, sondern solidarische Aktionsformen zu entwickeln. Dass dieses Unterfangen keinesfalls selbstverständlich ist, zeigt sich wiederkehrend, wenn ehemals wegbereitende Stimmen des deutschsprachigen Feminismus mit kolonialrassistischen Zuschreibungen und rechtspopulistischen Positionen kokettieren. Eine diskriminierungskritische Perspektive, so zeigt sich an solchem Beispiel, ist wertlos, wenn sie hinter dem emanzipatorischen, herrschaftskritischen Eigenanspruch und der Solidarität mit diskriminierten Gruppen zurückbleibt.
Ein dringender Auftrag für Jungen*arbeit zeichnet sich an dieser Stelle ab, wenn es darum geht, dass die Perspektiven von rassismuserfahrenen Jungen* und jungen Männern* sichtbarer werden. Da Jungen*arbeit im deutschsprachigen Raum zum überwiegenden Teil von weißen Fachkräften betrieben wird, besteht neben derer Sensibilisierung für intersektionale Diskriminierung ein entsprechender Bedarf an Jungenarbeiter*innen of color zur Verwirklichung von Empowerment-Ansätzen.
Anknüpfend daran soll die hier dargelegte intersektionelle Perspektive auf das Zusammenwirken von Rassismus und Männlichkeiten genutzt werden, um aktuelle politische Entwicklungen in Zeiten von steigendem Rechtsruck und Autoritarismus zu beleuchten.
Dekolonisierung von Männlichkeiten und die Kritik an Vater Staat
Die zunehmende Einschränkung und Beschneidung des Asylrechts und das seit Jahren beobachtbare Erstarken rechtspopulistischer Strukturen im europäischen Raum kämen in aller Regel kaum ohne die Inszenierung von Männlichkeiten aus.
Die „Legitimationslegenden“ (Rommelspacher), die genutzt werden, um rassistische Strukturen und Handlungen zu rechtfertigen, erzählen in aller Regel Geschichten mit männlichen* Protagonisten. Die vielzitierte Kölner „Silvesternacht“ 2015/2016 der sich eine massive rassistische Diskursverschiebung und mindestens 3.500 gewalttätige Übergriffe auf Geflüchtete und Geflüchtetenunterkünfte im Jahr 2016 anschlossen, bediente sich eines historisch kontinuierlichen Narrativs marginalisierter Männlichkeiten in Form des „übergriffigen Fremden“ einerseits und forderte auf der anderen Seite die Stabilisierung und Stärkung weiß-männlicher Hegemonie, die sich im Erstarken eines politischen Autoritarismus mit zutiefst antifeministischen Zügen äußert.
Ob nun der Ausruf einer „konservativen Revolution“, oder der Versuch feministische Diskurse rassistisch zu instrumentalisieren (was freilich nie über das paternalistische wie rassistische „Schützt unsere blonden Frauen“-Lamento hinausweist), während gleichermaßen notorisch „Genderwahn“ in die sozialen Kanäle geblökt wird, zeigt sich immer wieder, dass die vermeintliche autoritäre Revolte gleichermaßen die Sehnsucht nach der Herrschaft weißer Männer dokumentiert, mit Raewyn Connell gesprochen:
„Marginalisierung entsteht immer relativ zur Ermächtigung hegemonialer Männlichkeit in der dominanten Gruppe“. Gerade hieraus erwächst die Notwendigkeit, die Konstruktion von Männlichkeiten postkolonial zu denken, um zu verstehen, wie die Dämonisierung männlicher Geflüchteter als „projektiver Fokus und zugleich Garant für die Eindämmung europäisch-bürgerlicher Ängste“ fungiert.“ (Castro Varela 2016:10).
Folgen wir weiterhin Connells Analyse zur sozialen Konstruktion von Männlichkeiten als ein Zusammenspiel von Machtbeziehungen, Produktionsbeziehungen und emotionaler Bindungsstruktur (Kathexis), dann lässt diese den Schluss zu, dass die Geschichte globaler kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse und damit untrennbar verbunden auch die Geschichte kolonialer Ausbeutung gleichermaßen eine Geschichte von Männlichkeiten erzählt.
Alleine die Betrachtung von Kolonialgeschichte als militaristisches Unterfangen legt nahe, diese als Schauplatz von männlicher Inszenierung zu begreifen. Die Mechanismen, anhand derer die Erzeugung und Aufrechterhaltung von globalen Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnissen gerechtfertigt wird, nämlich in Form der Vorherrschaft weißer „zivilisierter“ Kolonialherren über unterlegene „unzivilisierttriebhafte“ fremde Männer sind bis in die Gegenwart wirkmächtig.
Mit Blick auf die Gegenwart Sozialer Arbeit schlägt sich diese Wirkmacht nicht nur in sozialen Ungleichheiten oder einer repressiven Gesetzgebung, sondern durchaus auch in bestehenden Förderstrukturen nieder. Was bedeutet es vor diesem Hintergrund, wenn in der Arbeit mit männlichen Geflüchteten innerhalb kürzester Zeit Förderungen in Bereichen von Prävention und Gefahrenabwehr bereitstehen, aber vergeblich auf die Etablierung von Schutzräumen gewartet wird, seien diese traumasensibel oder rassismuskritisch? Welches Mandat hat eine Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession gegenüber männlichen* Geflüchteten, die ihren Schutz vor Abschiebung einzig durch Zugang zu Arbeit absichern können und infolgedessen jedes noch so prekäre Beschäftigungsverhältnis in Kauf nehmen? Welchen Wert haben Projekte, die das Label „interkulturell“ bedienen, wenn die Diskriminierungserfahrungen von men of color* durch kulturalisierende Stereotype verdeckt, bzw. verstärkt werden? Und wie hoch ist die Bereitschaft, sich innerhalb von – teils öffentlichen – Strukturen Sozialer Arbeit kritisch mit dem Konstrukt der „Nation“ zu befassen, wenn die Sicherung und Abschottung nationaler Grenzen das Mittelmeer zum Massengrab macht?
Jungen*arbeit hat hierbei eine Schlüsselrolle in doppelter Hinsicht: einerseits in der Ermöglichung von Räumen als rassismuskritische Orte für betroffene Jungen* und junge Männer*, andererseits aber auch in der pädagogischen Entzauberung kolonialistischer „Heldengeschichten“. So wie es Jungen*arbeit schon immer inhärent war, geschlechtstypische Zu- und Festschreibungen an Männlichkeit zu dekonstruieren, so soll diese Dekonstruktion auch vor Männlichkeit als white supremacy nicht haltmachen.
Der pädagogische Auftrag, Jungen* in ihrer Entwicklung zu emotional und lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen ist daher sui generis an eine rassismuskritische, intersektionale Perspektive verwiesen.
Widerstände und Weißreflexe
Eine zentrale Herausforderung innerhalb der Trägerqualifikation der LAG Jungenabeit NRW bestand nun darin, die oben angeführten, häufig sehr abstrakt geführten Diskurse auf einer pädagogisch praktikablen Ebene zu beleuchten. Dazu ist zu bemerken, dass es sich im nachfolgenden Text lediglich um ausschnitthafte Beobachtungen aus der Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Organisationen handelt. Es geht dabei um exemplarische Situationen, die als Gesprächsanlässe oder Diskussionsgrundlagen nutzbar sein können, ohne dabei einen verallgemeinernden Anspruch zu verfolgen.
Überschneidend war dennoch, dass die Beschäftigung mit Rassismus häufig nach außen gerichtet war, beispielsweise in der Teilnahme an antifaschistischen Demos, der Durchführung von Aktionen gegen Rechtsextremismus, oder von Projekten zur „Interkulturellen Verständigung/Begegnung“. Seltener aber richtete sich der Blick auf die Innenperspektive und die Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichen und strukturellen Verankerung in rassistische Verhältnisse. Dies soll keinesfalls gegeneinander aufgewertet werden, denn das Positionieren und Solidarisieren gegen autoritäre und rassistische Strukturen ist gerade in Zeiten eines wachsenden rechten Selbstbewusstseins aktueller und notwendiger denn je.
Dennoch ist eine klassischerweise antirassistische Perspektive, die Rassismus externalisiert, mit deutlich weniger Widerständen konfrontiert als eine rassismuskritische Perspektive, die die eigene Betroffenheit und Verstrickung in eben jene Strukturen nachzeichnet. So plausibel diese Alltagsbeobachtung ist, so wichtig ist es, die erzeugten Widerstände differenziert und analytisch zu betrachten, denn dabei zeigten sich verschiedene Faktoren als ausschlaggebend. Es ist gerade für weiße Fachkräfte der Sozialen Arbeit eine ambivalente Aufgabe, sich mit der eigenen Privilegiertheit auseinanderzusetzen. Einerseits sind sie aus ihrer Profession heraus in Machtasymmetrien verwickelt, die sich schon aus dem Setting „helfender Berufe“ heraus ergeben.
Diskurse um Macht und Privilegien dürften, bzw. sollten an sich keiner Fachkraft, deren Arbeitsfeld sich aus Sozialer Ungleichheit und der Reflexion Sozialer Gerechtigkeit erschließt, fremd sein. Gleichzeitig basiert das Selbstverständnis häufig auf der Haltung, solidarisch mit der Zielgruppe zu sein und sich gegen Benachteiligung und gesellschaftliche Ausgrenzung zu engagieren, kurzum: zu „den Guten“ zu gehören. Es kann bei besagten Fachkräften dementsprechend Widerstände hervorrufen, anzuerkennen, dass sie ohne ihr aktives Hinwirken von einem rassistischen System profitieren.
Diese „rassistische Dividende“ äußert sich vor allem in Unausgesprochenem, bzw. Nichtvorhandenem und ist daher häufig unbewusst. Privilegierte sind in aller Regel gewohnt, im öffentlichen Raum repräsentiert zu sein, eine Stimme zu haben, Zugang zu Räumen zu erhalten, nicht Opfer rassistischer Gewaltakte zu werden, nicht in ungerechtfertigte Polizeikontrollen zu gelangen, etc., kurzum: dass bestehende Übereinkünfte und Ansprüche zum menschlichen Zusammenleben Gültigkeit für sie haben, dass sie in einem funktionierenden Gesellschaftssystem existieren, weil es für sie funktioniert.
Die Liste an Privilegien wird m. E. angeführt von dem Privileg, Rassismus als einen Diskurs wahrzunehmen, bei dem es in ihrer eigenen Entscheidungsgewalt liegt, ob sie sich an ihm beteiligen, oder entziehen. All dies sind per se keine moralisch verwerflichen Sichtweisen, sie können unter Umständen auf dem Glauben an die Universalität von Menschenrechten und an die Gleichwertigkeit aller Menschen beruhen (wohlgemerkt: können!). Sie tragen dennoch dazu bei, dass die Erfahrungen der negativ Betroffenen verschleiert und dethematisiert werden. Sie tragen auch dazu bei, dass die ohnehin ansozialisierten Machtstrukturen auch die Deutungsgewalt über den Rassismusbegriff monopolisieren.
Die wenigsten Einrichtungen haben den Prozess durchlaufen, sich teamübergreifend damit zu befassen, was Rassismus für sie und ihre Organisation bedeutet und mit welchem Begriff von Rassismus eigentlich gearbeitet wird. Dabei ist es entscheidend, welche Erfahrungshorizonte sich innerhalb eines Teams eröffnen, welche Positionen artikuliert und gehört werden und ob es für Fachkräfte mit Rassismuserfahrung Räume gibt, in denen ihre Erfahrungen überhaupt besprechbar werden. Nur auf dieser Grundlage kann es möglich sein, ebenjene geschützteren Räume auch für die Zielgruppe zu eröffnen.
Selbstverständlich verläuft der berufliche Alltag nicht in der hier anmutenden Dichotomie aus unreflektierten weißen Fachkräften und unsichtbaren Betroffenen. Selbstverständlich gibt es auch weiße Fachkräfte, die ein sehr hohes Maß an Reflexionsbereitschaft und rassismuskritischem Engagement in ihrer Rolle als Verbündete vorweisen. Und selbstverständlich gibt es auch hierbei keinen vereinheitlichten Diskurs und keine einheitliche Sicht gegenüber der dargelegten Perspektive von kritischem Weiß-sein.
So regen sich bei den bezeichneten Fachkräften auch Widerstände gegen das statische Verharren auf gesellschaftlicher Positioniertheit und die Gleichsetzung von subjektiv Erlebtem mit politischer Position. Kritisiert wird, dass antirassistische Politiken und Widerstandsstrategien durch das Verharren auf „Identitätspolitiken“ blockiert, bzw. entsolidarisiert werden (vgl. dazu auch: Karakayalı, Tsianos, Ibrahim 2013).
Dem ist entgegenzuhalten, dass die Perspektive von Critical Whiteness auf diese Weise unzureichend dargestellt wird und dass auch die oben bezeichneten antirassistischen Kämpfe nicht frei von Machtungleichgewichten und Paternalismus sind. Beide Positionen bergen die Gefahr in ein Entweder-oder abzudriften und sich gegeneinander auszuspielen. Es ist daher wichtig, die berechtigten Kritiken anzuerkennen und miteinander vereinend zu diskutieren, ohne dass der gemeinsame Fokus auf die Herstellung gerechterer Verhältnisse verloren geht.